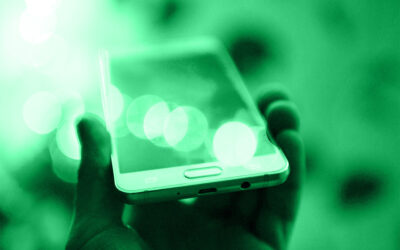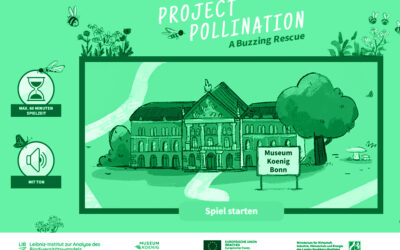Blog
„Gamification“ war lange ein Buzzword. Und ist noch immer ein unübersichtliches Feld. Vor über 10 Jahren hat unser Gründer Philipp angefangen über Gamification zu schreiben – mittlerweile haben wir eine der größten, ständig wachsenden Wissensdatenbanken dazu aufgebaut.
Von Grundlagen-Artikeln zum schnellen Überblick bis zu aktuellen News & Trends rund um Gamification, Game-based Learning, Serious Games und alles, was dazugehört.
Der ultimative Gamification Guide ist unser umfangreicher Überblicks-Post über unseren Blog – und immer ein guter Start. Darunter findet ihr unsere aktuellsten Beiträge.
Wenn ihr persönliche Beratung wünscht, könnt ihr uns auch direkt für Workshops, Talks oder Interviews anfragen.
Der ultimative Gamification Guide
Dieser Guide erklärt alles, was Sie über Gamification wissen müssen: Was ist Gamification? Wie geht man vor? Wo kann man es einsetzen?
Im Interview: Gaming im Business – nur mit Gamification-Agentur!
Was ist Gaming im Business und warum ist eine Gamification-Agentur wichtig? Das erklärt Philipp Reinartz im Interview mit dem Fusion Campus.
Pfeffermind stellt vor: Die Top Gamification-Trends 2024
Bei Pfeffermind wissen wir, was gerade im Trend liegt. Wir stellen die beliebtesten Anfragen und damit die Gamification Trends für 2024 vor.
Wie interaktives Marketing deine Marke auf ein neues Level hebt
Interaktives Marketing ist nicht nur aufmerksamkeitsstark, sondern fördert auch langfristige Kundenbindung. Wie schafft es das?
Escape Games für Unternehmen – ein Artikel im Tagesspiegel
Philipp Reinartz wurde vom Tagesspiegel interviewt. Die Themen: Escape Games für Unternehmen und die neue Berliner Förderung von Gamification.
Pfeffermind Release: Project Pollination – Ein Bildungsspiel über Bestäubung
Pfeffermind zeigt mit „Project Pollination“, wie ein Bildungsspiel über Biodiversität unterhaltsam und gleichzeitig lehrreich sein kann.
Pfeffermind in der Haptica – Analoge Gamification im Marketing
Die Haptica hat perfekt zusammengefasst was analoge Gamification im Marketing drauf hat: interaktive Erlebnisse, die Kund:innen begeistern.
Das Dream-Team Gamification und Kommunikation
Gamification und Kommunikation sind ein unschlagbares Team. Wie man durch spielerische Interaktion Botschaften effektiver vermittelt.
Games in der sozialen Kinder- und Jugendarbeit
Games sind eine nützliche Ressource in der sozialen Kinder- und Jugendarbeit. Doch wie kann man Spiele kreativ einsetzen?
Die vier Spielertypen nach Bartle
Richard Allan Bartle schuf ein Modell, das die Motivationen verschiedener Spielertypen verdeutlicht. Welche gibt es und wie nutzt man sie?
Nachhaltigkeit in Serious Games: ein Interview bei Haufe
Philipp Reinartz berichtete in einem Interview bei der Haufe Group, wie Unternehmen mit Serious Games zu mehr Nachhaltigkeit animieren.
Gamification-Expertise im Fernsehen: Pfeffermind in BR Doku
Was Pfeffermind mit seiner Gamification-Expertise zu der neuen Dokumentation „Win Win“ beitragen konnte, erfahrt Ihr hier.
Wie Gamification und SDT-Modell die Motivation steigern
Motivation treibt uns Menschen an. Aber wie genau können wir uns motivieren? Gamification und das SDT-Modell liefern die Antwort.